
Flora von Bayern: Bayern als Lebensraum für Pflanzen
Alle rund 6000 historisch und aktuell in Bayern nachgewiesenen Arten im Porträt
Bayern ist aufgrund seiner naturräumlichen Ausstattung das deutsche Bundesland mit der größten Anzahl von Farn- und Blütenpflanzen. In der Flora von Bayern werden erstmals alle 6000 in Bayern historisch und aktuell nachgewiesenen Pflanzen dokumentiert. Dabei werden Arten, Unterarten, Varietäten und Naturhybriden, indigene Pflanzen wie auchsowie spontane und etablierte Neophyten, berücksichtigt. Alle indigenen Arten sowie die etablierten Neophyten werden dabei mit den diagnostischen Merkmalen kurz beschrieben, inklusive Angaben zu Wuchsort und Lebensraum, Verbreitung in Bayern, Gefährdung und Schutz. Fast allen beschriebenen Arten ist eine Verbreitungskarte mit historischen und aktuellen Funddaten beigegeben. Bemerkenswerte, seltene oder für Bayern bedeutsame Arten werden zusätzlich anhand von Farbfotos illustriert.
Besonderes Gewicht wird auch auf kritische, schwer zu bestimmende Gattungen und Artengruppen gelegt. Die Flora von Bayern wendet sich sowohl an Naturfreunde und Pflanzeliebhaberinnen, Floristinnen und Botaniker und sie bietet eine Grundlage für die naturschutzfachliche Arbeit.
Die letzte «Flora von Bayern» erschien vor 110 Jahren (Vollmann 1914*), der «Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayern» vor 34 Jahren (Schönfelder & Bresinsky 1990**). Seitdem hat sich das Wissen um Bayerns Flora, vor allem bedingt durch die unschätzbare Leistung vieler eifriger ehrenamtlich an der Kartierung Beteiligten, enorm vergrößert: der Kartierstand der floristischen Erfassung Bayerns stieg an von etwa 1 Million Datensätzen zu Zeiten des Bayernatlas auf heute 15,94 Millionen Datensätze.

© Andreas Fleischmann
In unserer neu erschienenen «Flora von Bayern» werden nun alle rund 6000 historisch und aktuell in Bayern nachgewiesenen Arten im Porträt vorgestellt. Damit ist sie das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Dokumentation.
Einen kleinen Einblick in dieses Monumentalwerk, das übrigens knapp 14 Kilo auf die Waage bringt, geben wir Ihnen hier im Folgenden und zeigen, was Bayern als Lebensraum für Pflanzen ausmacht. Ein paar Bilder von Vegetationstypen runden den Beitrag ab. Und für alle, die sich für Statistik interessieren, haben wir am Ende noch die wichtigsten Zahlen aufgelistet.
Doch bevor wir starten, müssen wir den Begriff «Flora» differenzieren: Einerseits ist Flora die Gesamtheit aller Pflanzensippen (Taxa) eines Gebietes.
Eine Flora ist hingegen ein Buch, das die Pflanzensippen eines Gebietes aufzählt
und in unterschiedlicher Weise mit zusätzlichen Informationen versieht. Und damit haben wir es hier zu tun.
*Vollmann, F. 1914a: Flora von Bayern, 840 Seiten, Verlag Ulmer Stuttgart. / **Schönfelder, P. & Bresinsky, A. (Hrsg.) 1990: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. 752 S., Stuttgart.
BAYERN ALS LEBENSRAUM FÜR PFLANZEN
Bayern ist aufgrund seiner naturräumlichen Ausstattung das deutsche Bundesland mit der größten Anzahl von Farn- und Blütenpflanzen. Als größtes deutsches Bundesland mit einer Fläche von 70.550 km² nimmt es den Südosten Deutschlands ein. Der Freistaat erstreckt sich von der Rhön im Norden bis zu den Nördlichen Kalkalpen im Süden, vom Nördlinger Ries im Westen bis zum Bayerischen Wald im Osten. Aus der Überlagerung von natürlichen und menschlichen Einflüssen ergibt sich eine bemerkenswerte Vielfalt von Flora und Vegetation.
- Fotos: Andreas Fleischmann
Umweltfaktoren
Die auf Pflanzen wirkenden Standortfaktoren werden maßgeblich
durch das Zusammenwirken von Relief, Böden und Klima bestimmt.
Geologie und Böden: Die Ausgangsgesteine bestimmen durch ihren Mineralbestand (Chemismus, Korngröße, Verwitterbarkeit) die Erosionanfälligkeit, den Wasserhaushalt (Speicherkapazität, Durchlässigkeit) und das Nährstoffangebot der Böden.
Böden sind ein Gemisch aus mineralischen Verwitterungsprodukten mit organischen Substanzen und Mikroorganismen. In ihren Poren befinden sich in wechselnden Anteilen Luft und Bodenwasser, mit dem die Pflanzenwurzeln gelöste Nährsalze aufnehmen. Für Pflanzen wesentliche Bodeneigenschaften, von Ellenberg
et al. (2001*) als ökologische Zeigerwerte codiert, sind pH-Wert und Basensättigung, der Wasser- und Lufthaushalt sowie die Verfügbarkeit der Makronährelemente Stickstoff, Phosphor und Kalium, welche in naturnahen Ökosystemen aus dem Humusumsatz, in landwirtschaftlichen Böden durch Düngung bereitgestellt werden.
*Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V. & Werner, W. 2001: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. – Scripta Geobotanica 18(4.): 262.
Klima: Als Klima bezeichnet man den mittleren physikalischen Zustand der Atmosphäre über eine Referenzperiode (meist drei Jahrzehnte, hier 1971–2000). Mit Jahresdurchschnittstemperaturen von –4,6–10,1° C und gleichmäßig über das Jahr verteilten Niederschlägen von 575–2025 mm gehört Bayern zur kühl gemäßigten Klimazone. Die Westwinddrift führt vorwiegend feuchte Luftmassen nach Bayern. Im ozeanischen Nordwesten sind die Niederschläge gleichmäßig über alle Monate verteilt, während sie in weiten Teilen Bayerns ein ausgeprägtes Sommermaximum aufweisen. Da der maritime Einfluss regelmäßig durch trockene, im Winter kalte, im Sommer heiße kontinentale Hochdrucklagen abgelöst wird, spricht man von einer subatlantischen Klimatönung.
Ausgewählte Vegetationsbilder und Vegetationstypen aus Bayern
Folgende Bilder bedürfen nicht viel Text, sondern sollen die Vielfalt der Vegetationsbilder Bayerns veranschaulichen:

Ackerbrache im Vertragsnaturschutz, mit Papaver rhoeas, Anthemis austriaca, Vicia glabrescens u. a., Karlstadt, Unterfranken. 15.06.2021. Foto: Marcel Ruff.

Flugsand-Binnendünen mit Silbergras (Corynephorus canescens) in lockerem Kiefernwald, Siegenburg, Niederbayern. 29.05.2022. Foto: Marcel Ruff.

Artenreiche Saumgesellschaft mit wärmeliebenden Arten u. a. Buphthalmum salicifolium, Centaurea scabiosa, Galium boreale, Briza media. 27.06.2021. Foto: Marcel Ruff.

Salztolerante Ruderalvegetation am Autobahnmittelstreifen, hier Cuscuta campestris parasitierend auf Senecio inaequidens, A8 bei Frasdorf, Chiemgau, Oberbayern, 22.07.2024.
Foto: Andreas Fleischmann.

Erlenbruchwald, Lech-Altarm bei Mundraching, Oberbayern, 26.04.2015. Foto: Andreas Fleischmann.

Artenreiche, beweidete Streuwiese u. a. mit Dactylorhiza majalis und Lychnis floscuculi, Oberbayern. 26.05.2024. Foto: Marcel Ruff.

Flach- und Übergangsmoor, Pfrühlmoos, Oberbayern. 25.07.2022. Foto: Marcel Ruff.

Alpines Kalkflachmoor (Verlandungsmoor eines Karsees) mit Eriophorum scheuchzeri und E. latifolium, Schrecksee, Allgäuer Alpen, 06.09.2013. Foto: Andreas Fleischmann.

Farn- und krautreicher Unterwuchs im Berg-Mischwald, Hintersteiner Tal, Allgäuer Alpen, 05.09.2013. Foto: Andreas Fleischmann.
Statistik und Sippenbilanzen
Zum Schluss ist es sicher für den einen oder die andere interessant, sich mit den Zahlen zu beschäftigen. In der «Flora von Bayern» sind folgende Sippen nachgewiesen und größtenteils mit Foto und Verbreitungskarte aufgelistet.
- Taxa insgesamt: 5886
- davon Arten: 4778
- Unterarten: 1313
- Varietäten: 109
- Hybriden: 708
Nicht mit in diese Sippengesamtbilanz eingerechnet, aber im Werk ebenfalls behandelt sind folgende Kategorien:
- Aggregate: 48
- für Bayern (früher) erwähnte Sippen, deren Vorkommen nicht gesichert oder fraglich ist: 97
- für Bayern (früher) erwähnte Sippen, deren Vorkommen irrig oder falsch ist: 116
Von den insgesamt 5886 in Bayern nachgewiesenen Pflanzen-Sippen sind:
- Indigene (Einheimische, einschließlich Archäophyten): 3065
- davon ausgestorben oder verschollen: 82 (davon allerdings bei 9 unklar,
ob wirklich indigen) - davon aktuell noch im Gebiet vorkommend: 2983
- Neophyten: 1955
- Davon Eingebürgerte (etablierte Neophyten): 380
- Davon Neophyten mit Tendenz zur Etablierung im Gebiet: 208
- Davon unbeständig adventive Neophyten, Kulturflüchtlinge: 1367
- Kultivierte (im Gebiet nur kultiviert oder forstlich eingebracht vorkommende Pflanzensippen):103
Die Bayerische Botanische Gesellschaft ist eine Vereinigung floristisch interessierter Fachleute und Pflanzenliebhaber/innen, sie wurde 1890 gegründet und widmet sich seither der Erforschung, Erfassung und dem Schutz der Pflanzenwelt Bayerns. Sie ist gemeinnützig und wird ehrenamtlich geleitet. Die Gesellschaft hat derzeit ca. 730 Mitglieder.

Lenz Meierott (*1942) studierte Schulmusik und Querflöte an der Musikhochschule München, 1974 promovierte er in Musikwissenschaft an der Universität Würzburg. Von 1979 bis zu seiner Pensionierung 2007 hatte er eine Professur an der Musikhochschule Würzburg inne. Neben der Musik gilt sein Interesse der Botanik. Über 50 Jahre beteiligte er sich an der Floristischen Kartierung Bayerns, intensiver beschäftigte er sich auch mit den kritischen Gattungen Hieracium, Rubus, Sorbus und Taraxacum. Für seine "Flora der Haßberge und des Grabfelds" (2008) wurde ihm der Akademiepreis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften verliehen. Vier Pflanzenarten sind nach ihm benannt.

Andreas Fleischmann (*1980) studierte Biologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 2011 promovierte und 2021 zu Pflanze-Tier-Interaktionen von karnivoren Pflanzen habilitierte. Seit 2014 ist er Wissenschaftler und Kurator für Blütenpflanzen an der Botanischen Staatssammlung München, seit 2021 zudem Privatdozent für Systematische Botanik an der LMU München. Seine Forschungsgebiete sind die Biologie, Systematik und Evolution von fleischfressenden und parasitischen Pflanzen, sowie Bestäubungsbiologie und Pflanze-Tier-Interaktionen. Daneben engagiert er sich im Natur- und Artenschutz, vor allem zur Förderung von Artenvielfalt im urbanen Raum. Seit 2020 ist er Erster Vorsitzender der Bayerischen Botanischen Gesellschaft.

Marcel Ruff (*1983) studierte Biodiversität und Ökologie (B.Sc.) an der Georg-August-Universität Göttingen, sowie Umweltplanung und Ingenieurökologie (M.Sc.), mit Schwerpunkt Vegetationsökologie, an der Technischen Universität München. Von 2015 bis 2020 arbeitete er an der Koordinationsstelle Bayernflora überwiegend im Bereich Kuration der Daten der Flora von Bayern. Seit 2020 ist er am Bayerischen Artenschutzzentrum im Landesamt für Umwelt für botanischen Artenschutz zuständig. Aufgabenschwerpunkte sind Artenhilfsprogramme, die Erstellung der Roten Liste der Gefäßpflanzen, die Zusammenarbeit mit der floristischen Kartierung und das FFH-Monitoring.
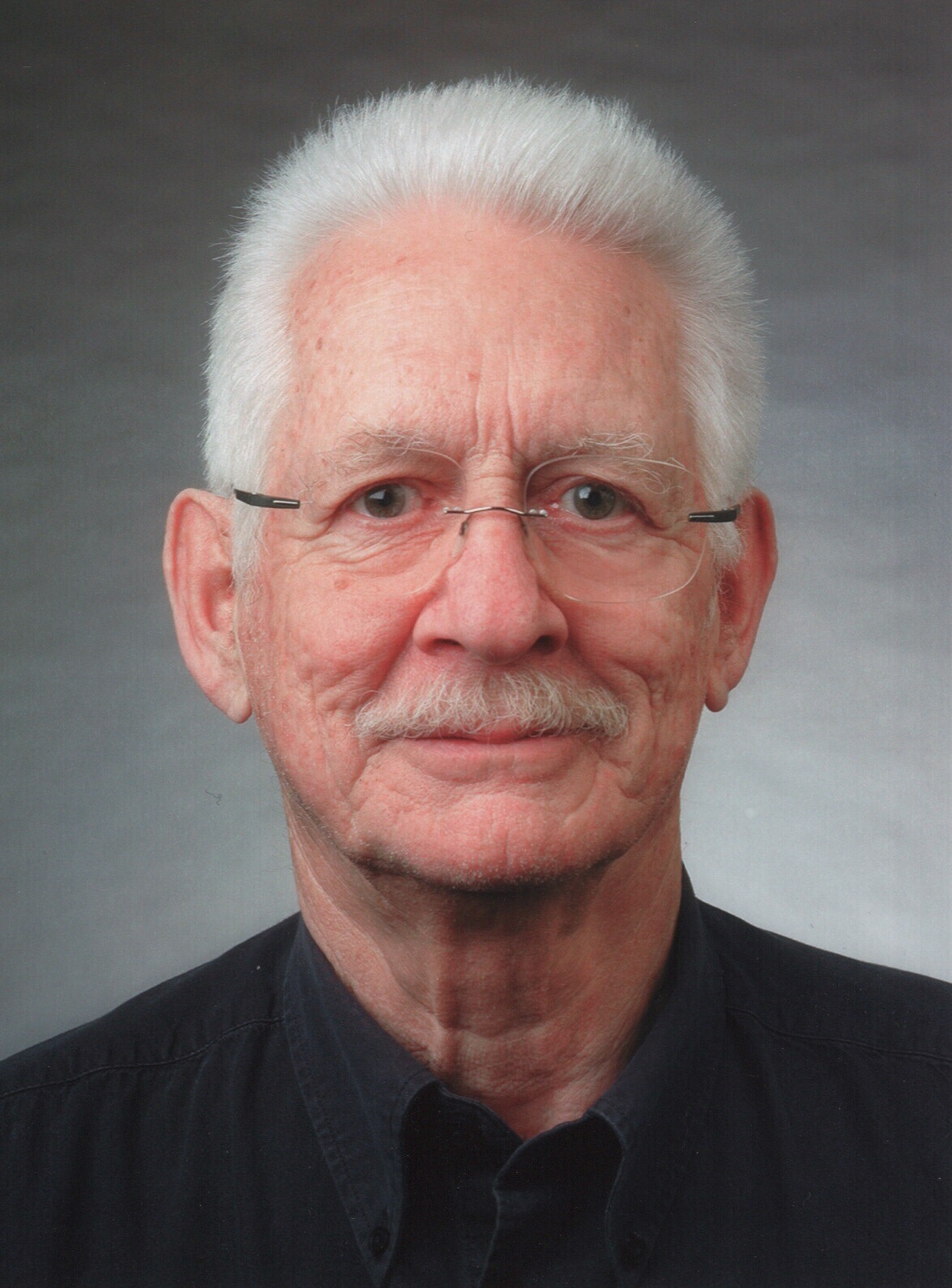
Wolfgang Lippert (1937-2018) studierte Biologie, Chemie und Geographie auf Lehramt an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 1966 über "Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes Berchtesgaden" promovierte. Von 1967-2002 war er Kurator an der Botanischen Staatssammlung München. Er war ein ausgezeichneter Kenner der mitteleuropäischen Blütenpflanzen und der Flora Bayerns, seine Forschung umfasste vor allem taxonomisch schwierige Gattungen wie Alchemilla, Crataegus und Festuca. Von 1980-2005 war er Erster Vorsitzender der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, seit 2005 ihr Ehrenvorsitzender. 2009 erhielt er für seine Verdienste um die Botanik und den Naturschutz in Bayern das Bundesverdienstkreuz.













